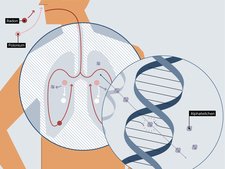-
Themen
Unternavigationspunkte
Themen
Elektromagnetische Felder
- Was sind elektromagnetische Felder?
- Hochfrequente Felder
- Was sind hochfrequente Felder?
- Quellen
- Schnurlose Festnetztelefone
- Kabellose Geräteverbindungen
- Kabellose In-Ear-Kopfhörer
- Babyüberwachungsgeräte
- BOS-Funk
- Freie Sprechfunkdienste und Amateurfunk
- Rundfunk und Fernsehen
- Mikrowellenkochgeräte
- Intelligente Stromzähler - Smart Meter
- Ganzkörperscanner
- Radaranlagen
- Wirkungen
- Schutz
- Strahlenschutz beim Mobilfunk
- Statische und niederfrequente Felder
- Strahlenschutz beim Ausbau der Stromnetze
- Strahlenschutz bei der Elektromobilität
- Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder
Optische Strahlung
- Was ist optische Strahlung?
- UV-Strahlung
- Sichtbares Licht
- Infrarot-Strahlung
- Anwendung in Medizin und Wellness
- Anwendung in Alltag und Technik
Ionisierende Strahlung
- Was ist ionisierende Strahlung?
- Radioaktivität in der Umwelt
- Wo kommt Radioaktivität in der Umwelt vor?
- Natürliche Strahlung in Deutschland
- Luft, Boden und Wasser
- Radon
- Lebensmittel
- Welche Radionuklide kommen in Nahrungsmitteln vor?
- Natürliche Radioaktivität in der Nahrung
- Natürliche Radioaktivität in Paranüssen
- Strahlenbelastung von Pilzen und Wildbret
- Strahlenbelastung durch natürliche Radionuklide im Trinkwasser
- Natürliche Radionuklide in Mineralwässern
- Baumaterialien
- Altlasten
- Industrielle Rückstände (NORM)
- Labore des BfS
- Anwendungen in der Medizin
- Diagnostik
- Früherkennung
- Strahlentherapie
- BeVoMed: Meldung bedeutsamer Vorkommnisse
- Verfahren zur Strahlenanwendung am Menschen zum Zweck der medizinischen Forschung
- Orientierungshilfe
- Allgemeines und Veranstaltungshinweise
- Neuigkeiten zum Verfahren
- FAQs: Einreichung bis 30.06.2025
- FAQs: Einreichung ab 01.07.2025
- Anzeige mit Einreichung bis 30.06.2025
- Antrag auf Genehmigung bis 30.06.2025
- Anzeige mit Einreichung ab 01.07.2025
- Antrag auf Genehmigung ab 01.07.2025
- Abbruch, Unterbrechung oder Beendigung
- Registrierte Ethik-Kommissionen
- Anwendungen in Alltag und Technik
- Radioaktive Strahlenquellen in Deutschland
- Register hochradioaktiver Strahlenquellen
- Bauartzulassungsverfahren
- Gegenstände mit angeblich positiver Strahlenwirkung
- Handgepäck-Sicherheitskontrollen
- Radioaktive Stoffe in Uhren
- Ionisationsrauchmelder (IRM)
- Strahlenwirkungen
- Wie wirkt Strahlung?
- Wirkungen ausgewählter radioaktiver Stoffe
- Folgen eines Strahlenunfalls
- Krebserkrankungen
- Vererbbare Strahlenschäden
- Individuelle Strahlenempfindlichkeit
- Epidemiologie strahlenbedingter Erkrankungen
- Ionisierende Strahlung: positive Wirkungen?
- Strahlenschutz
- Nuklearer Notfallschutz
- Serviceangebote
-
BfS
Unternavigationspunkte
BfS
- Stellenangebote
- Arbeiten im BfS
- Wir über uns
- Wissenschaft und Forschung
- Forschung im BfS
- Gesellschaftliche Aspekte des Strahlenschutzes
- Natürliche Strahlenexposition
- Wirkung und Risiken ionisierender Strahlung
- Medizin
- Notfallschutz
- Radioökologie
- Elektromagnetische Felder
- Optische Strahlung
- Europäische Partnerschaft
- Wissenschaftliche Kooperationen
- Gesetze und Regelungen
- Strahlenschutzgesetz
- Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung
- Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkungen nichtionisierender Strahlung (NiSV)
- Häufig genutzte Rechtsvorschriften
- Dosiskoeffizienten zur Berechnung der Strahlenexposition
- Links
- Services des BfS
- Stellenangebote
Radon: Weiterer Beleg für Risiko bei relativ niedriger Exposition
Radon erhöht das Lungenkrebsrisiko. Dies wurde zuerst durch die Auswertung von Gesundheitsdaten von Uran-Bergarbeitern, die zum Teil sehr hohen Radon-Konzentrationen ausgesetzt waren, wissenschaftlich belegt. Doch auch bei vergleichsweise geringen Radon-Konzentrationen, wie sie heutzutage an manchen Arbeitsplätzen und teilweise in Wohnungen auftreten können, steigt das Lungenkrebsrisiko linear mit Höhe der Gesamtexposition.
Das ist ein Teilergebnis der PUMA-Studie (Pooled Uranium Miners Analysis), in der unter Beteiligung von Wissenschaftler*innen des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) die Daten von sieben Uran-Bergarbeiterstudien aus den USA, Frankreich, Kanada, Tschechien und Deutschland gemeinsam ausgewertet werden. Die Auswertung, die in "Environmental Health Perspectives" veröffentlicht wurde, bestätigt die Ergebnisse früherer Untersuchungen, die sich auf eine deutlich kleinere Datenbasis stützen.
Lungenkrebsrisiko hängt nicht nur von der Höhe der Exposition ab
Neben der Höhe der Gesamt-Radon-Exposition beeinflussen zwei weitere Faktoren das Lungenkrebsrisiko:
- Unabhängig davon, zu welchem Zeitpunkt die Bergarbeiter dem Radon ausgesetzt waren, sinkt mit höherem Alter das Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.
- Liegt die Exposition länger als 15 Jahre zurück, nimmt das Lungenkrebs-Risiko tendenziell wieder ab.
Auch hier untermauert die Auswertung der PUMA-Studie, dass die Zusammenhänge zwischen Radon und Lungenkrebs, die bei hohen Radon-Expositionen beobachtet wurden, auch für vergleichsweise geringe Expositionen gelten.
Erkenntnisse für heutigen Strahlenschutz relevant

![]() Bergarbeiter unter Tage beim Bohren im Wasser stehend
Bergarbeiter unter Tage beim Bohren im Wasser stehend
In die Auswertung flossen Daten von knapp 58.000 männlichen Bergarbeitern ein, die ihre Tätigkeit im Uranbergbau 1960 oder später begonnen hatten. Während in den Anfangsjahren des Uranbergbaus kaum Strahlenschutzmaßnahmen ergriffen wurden, waren sie in den 1960er Jahren bereits so etabliert, dass die Bergarbeiter nur noch vergleichsweise geringen Radon-Konzentrationen ausgesetzt waren. Damit sind die Erkenntnisse aus der Studie auch für den heutigen Strahlenschutz an Arbeitsplätzen und für den Schutz der Bevölkerung vor Radon relevant.
Die PUMA-Studie
Die PUMA-Studie fasst die Daten von weltweit fast 125.000 Bergarbeitern zusammen, die zwischen 1942 und 1996 im Uran-Bergbau tätig waren. Als größte Einzelstudie trägt die Wismut Uranbergarbeiter-Studie fast die Hälfte des gesamten Datenumfangs bei. Die Wismut-Studie ist eine vom BfS durchgeführte Kohortenstudie zu 64.000 ehemaligen Beschäftigten des Uranerzbergbaus der Wismut in Thüringen und Sachsen.
Die PUMA-Studie wird auch weitere Erkenntnisse zu der Frage liefern, ob Radon andere Erkrankungen als Lungenkrebs verursachen kann.
Stand: 07.06.2022